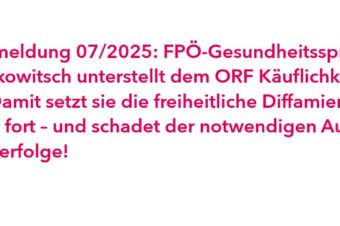Interview: Adina Camhy; Transkript: Franz-Josef Windisch-Graetz ◄
Andrea Jany (Architektin und Wohnbauforscherin) im Gespräch über „Betongold“, die Player am Wohnungsmarkt und Perspektiven für alternative Wohnformen in Graz.
Grazotopia: Mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich aktuell in Ihrer Forschung?
Andrea Jany: Meine Hauptforschung wurde letztes Jahr als Buch Experiment Wohnbau (Berlin: Jovis, 2019) publiziert. Geografisch betraf diese die gesamte Steiermark und thematisch Experimente im Wohnbau in den 1980er Jahren. In der Steiermark waren das 28 Projekte. Diese haben gezeigt, was Wohnbau alles kann, wenn man sich im Vorfeld – in der Planungsphase – intensiv mit den Bewohner*innen auseinandersetzt. Einige der Projekte wurden in Graz, andere im Rest der Steiermark realisiert.
Was sind die größten Herausforderungen in Bezug auf Wohnen und Wohnbau in Graz?
Im Ballungsgebiet Graz ist das definitiv der Zuzug. Gegenwärtig wird der Umgang damit durch das neoliberale Gedankengut geprägt. Dabei geht es hauptsächlich um Gewinnmaximierung – es werden größtenteils von Investoren initiierte Projekte realisiert, die Profite aus der Errichtung generieren. Generell tut das einer Stadt und deren Bevölkerung nicht gut. Obwohl Wohnen keine Ware ist, die wie jedes andere Handelsgut dem Profit unterliegen darf, wird es dennoch so gehandhabt. Daraus resultiert, dass es in Graz mittlerweile viele Projektentwickler gibt, die dieses Geschäftsmodell forcieren. Das Credo „Wir müssen bauen, bauen, bauen und damit sinken die Durchschnittspreise!“ stimmt nicht. Darüber hinaus gibt es in Graz eine sehr ungleichmäßige Verteilung. Das ist mein subjektiver Eindruck, denn es gibt darüber keine zusammenfassenden Studien, Zahlen und Fakten. Es lässt sich aber beobachten, wie sich Gentrifizierung im Bezirk Lend auswirkt und wie diese langsam im Bezirk Gries beginnt. Es werden Grundstücke aufgekauft und es wird versucht diese aufzuwerten, hierdurch entsteht das so bezeichnete „Betongold“. Die langansässige Bevölkerung wird in dem Prozess meist verdrängt.
Für wen wird gebaut? Welche Wohntypologien und Wohnmodelle dominieren? Gibt es auch Formen gemeinschaftlichen Wohnens?
Nein, das sind hauptsächlich Bauträger- und Investorenprojekte. Grundrisse von Wohnungen, die ich kenne, tendieren immer mehr in Richtung kleinerer Flächen: Minimieren im Grundriss, aber Maximieren auf dem Grundstück. Das Ziel ist, möglichst viele Wohneinheiten auf dem Grundstück unterzubringen. Es gibt keine bedürfnisorientiert geplanten Projekte – der Mensch, der einzieht, bleibt anonym.

© Gustav Peichl
Wer sind die größten Investoren, die in Graz bauen?
Das müsste man recherchieren. Spontan fällt mir z. B. die klassische Strobl-Oasis Linie ein. Auch Pongratz ist meines Wissens sehr aktiv. Darüber hinaus haben auch gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften ihre „Luxuslinien“. Das sind alles Akteure, die durch Wohnungsbau Profite generieren.
Welche Rolle spielen gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften beim Neubau von Wohnungen?
Meist bauen sie Wohnsiedlungen an der Peripherie, gelegentlich auch in innerstädtischen Lagen. Die Konzeption ist überwiegend einfach und anonym, man könnt sagen jeweils ein vervielfachter Nullachtfünfzehn-Wohnbau. Parallel werden von den Genossenschaften auch private Wohnbauschienen geplant, gebaut und verwaltet. Mit dem Wissen durch den geförderten Wohnbau, das intern dauerhaft generiert wird, erwirtschaften sie Profite.
Die WoGen Wohnprojekte-Genossenschaft, die auch das Projekt KooWo Volkersdorf realisiert hat, scheint bei der Umsetzung alternativer und partizipativer Projekte allein auf weiter Flur zu sein.
Die WoGen wurde in der Wiener Szene gegründet. Durch Zufall ist kürzlich in der Nähe von Graz ein Wohnprojekt, das erste der WoGen, realisiert worden, aber sie sind nicht in der Steiermark verankert.
Es gibt vonseiten der baugenossenschaftlichen Bauträger keine partizipativen Wohnprojekte. Das ist auch nicht gewollt. Sie sind mit ihrem Geschäftsmodell seit Jahrzehnten erfolgreich. Es gibt keinen Grund etwas zu verändern. Und sie stehen auch nicht in der breiten Bevölkerung in Verruf. Während sie über die eine, reguläre Schiene die Förderung abholen und einfachen, standardisierten Wohnbau realisieren, haben sie auch eine zweite Schiene. Die Wohnbauten haben meist keinerlei Bezug zur Umgebung und zu den Bewohner*innen. Das ist wirklich sehr einfach, anonym, nüchtern und ohne jeglichen Sinn für eine weitreichende Gestaltung. Ich denke Ironimus brachte es bereits 1969 mit seiner Karikatur „Der Wohnbaubomber“ sehr gut auf den Punkt. Ein überquerendes Flugzeug betitelt als Wohnbaugenossenschaft „Schöne Welt“ wirft monotone Einheitswohnbauten über der Landschaft ab, diese variieren in ihrer Größe, gleichen sich jedoch in der Typologie.
Wieso hat es nach dem Modell Steiermark nichts Vergleichbares mehr gegeben? Spielen da einzelne politische Entscheidungsträger*innen eine besondere Rolle?
Ja, ganz sicher. Es braucht jemanden, der dahinter steht und die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit von Wohnbau erkennt. Denn Wohnen ist etwas, dass die Menschen im Alltag prägt, jeden unmittelbar betrifft und darüber hinaus weitreichende Auswirkungen hat – z. B. auf das gesamte Stadtgefüge aber auch auf die persönliche Psyche. Dafür gibt es zu wenig Bewusstsein. Es ist sicher auch der politischen Verantwortung geschuldet, dass solche Themen öffentlich nicht ausreichend diskutiert werden. Und gerade auch das Modell Steiermark wird als Argument herangezogen, da damals viel Experiment gewagt wurde – die Genossenschaften tragen bestimmte Schwachstellen nach wie vor nach vorn. Sie argumentieren z. B., dass die im Rahmen des Modell Steiermark realisierten Projekte immer noch Bauschäden aufweisen. Damals sind natürlich auch Fehler passiert. Jeder Bau, jede Baustelle weist Fehler auf – vielleicht damals vermehrt, weil sehr viel improvisiert und auch experimentiert wurde. Das Gesamtkonzept und gerade das soziale Konzept hat aber sehr wohl Bestand und das gilt auch heute, nach vierzig Jahren.
Was für unterschiedliche Beteiligungsformen, partizipative Wohnformen, Bottom-up-Projekte, Baugruppen, alternative Wohnformen gibt es heute in Graz?
Die KooWos in Volkersdorf sind definitiv ein Lichtblick. Es ist wichtig, dass wir ein solches Beispiel vor den Toren von Graz haben – zum Anschauen für alle, auch für Entscheidungsträger*innen. Zusätzlich gab und gibt es in der Stadt immer wieder Initiativen. Eine davon war z. B. die Kumpanei, und heute ist der Club Hybrid aktiv. Es gibt auch immer wieder kleine Initiativen innerhalb der Architekt*innenschaft. Leider ist es sehr schwierig, solche Projekte zu realisieren, da Baugruppen einen erschwerten Zugang zu Grundstücken haben. Daran aber steht und fällt alles. Das Riesenglück der KooWos war, dass sie ein Grundstück hatten. Für sie war es klar, dass sie es entweder dort oder gar nicht realisieren. Die anderen Gruppen haben es nicht geschafft – unter anderem deshalb, weil man bei der Akquise eines passenden Grundstücks keine Unterstützung seitens der Stadt oder des Landes bekommt. Sie erkennen diese Notwendigkeit leider nicht. Ein Hilfsmittel könnte darin bestehen, dass man gerade in neuen Stadtplanungsgebieten wie Reininghaus oder der My Smart City Graz Flächen für Baugruppen reserviert – so wie das in Wien praktiziert wird. Verschiedene Baugruppen könnten sich dann mit ihren Konzepten für diese Grundstücke bewerben.
Was sind die Gründe dafür, dass Baugruppenprojekte in Wien ganz anders gehandhabt werden?
Die politische Struktur – das ist recht eindeutig. Es gibt bzw. gab in Wien vor allem zwei Entscheidungsträger, die zu diesem Thema stehen. Sie haben die Grundstücksvergaben bzw. Konzeptverfahren und Baugruppen ideell maßgeblich unterstützt.
Auch das Modell Steiermark wurde damals von der Politik vorangetrieben. Hermann Schaller und Wolfdieter Dreibholz haben Impulse gesetzt und den Rahmen aufgespannt, der von den einzelnen Initiativen befüllt werden konnte.
Sie forschen auch zum Thema „Leerstand“, zum Beispiel in Knittelfeld.
Momentan machen wir eine Wohnbedarfsanalyse in Knittelfeld. Leerstand ist ein Teilaspekt dieser Studie – wir brauchen Daten zum Leerstand, um den Wohnbedarf zu erheben. Knittelfeld ist die erste Gemeinde, die sich traut, dieses Thema anzugehen, um zukunftsorientiert ihre Flächen und Gebäude im Gemeindeareal zu verteilen und zu verwalten.
Haben Sie Erfahrungswerte in Bezug auf den Leerstand in Graz?
Es wird seit Jahren vergeblich versucht, in Graz eine Leerstandserhebung zu machen. Bis das geschieht, sind alle Einschätzungen rein spekulativ. Mein subjektiver Eindruck ist, dass es viel Leerstand gibt, auch in Neubauprojekten. Meiner Meinung nach werden auch die Leerstandserhebungen genau von diesen Projektentwicklern/Bauträgern verhindert. Die Investoren werden natürlich geholt, um Geld nach Graz zu bringen. Und wenn man zu viel Leerstand hätte, dann würden keine Investoren mehr kommen. Das verstehe ich auch, weil deren Geschäftsmodell damit kaputt ginge, aber ich verstehe nicht, warum die Politik sich darauf einlässt. Politiker*innen sind nicht auf dieses Geschäftsmodell angewiesen. Sie müssten den größeren Blick behalten und sagen: Leerstandserhebung ist für uns als Stadt wichtig, damit wir bedarfs- und bedürfnisgerecht entwickeln und planen können.
Wie ist das mit dem Leerstand in den Neubauprojekten? Kann trotz Leerstand Profit erzielt werden?
Vermutlich wird Leerstand von vornherein mit einberechnet. Es muss so sein, damit sich das Geschäft trotzdem rentiert. Ich weiß allerdings nicht, mit wie viel Prozent Leerstand schlussendlich gerechnet wird.
Mit welchen Methoden wird der Leerstand in Knittelfeld erfasst? Es gibt vonseiten der Grazer Stadtpolitik das Argument, eine solche Erhebung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht durchführen zu können.
Ja, es ist aufwändig. Es wird ein Methodenmix aus qualitativer und quantitativer Forschung angewandt. So gibt es z. B. die Möglichkeit, die Stromzähler zu beobachten oder zu schauen, ob die Müllabfuhr für ein Haus gebucht worden ist. Das sind Aspekte, die man heranziehen kann. Es gibt aber auch Datenbanken, die von den einzelnen Gemeinden befüllt und die auch aktuell gehalten werden müssen. Man muss verschiedene Daten kombinieren, um ein bestmögliches Bild zu erhalten.
Wo wäre im Hinblick auf das Wohnen in Graz politische Einflussnahme dringend gefordert?
Zunächst braucht es Menschen in den Entscheidungspositionen, die das Thema Wohnen als ein vorrangiges erkennen und ausweisen. Und erst wenn nicht nur quantitative sondern auch qualitative Ziele forciert werden, können wir gemeinsam passende Instrumente entwickeln. Aktuell ist es nicht möglich zu sagen: Das und das machen wir und das funktioniert. Denn jede Stadt ist ein bisschen anders. Man muss es sich explizit für Graz anschauen und ein größeres Konzept bzw. eine Strategie erarbeiten. Das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln – dafür ist eine umfassende Forschung und viel Überlegung nötig.