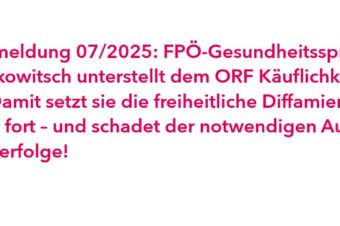Regina Appel ◄
Am Anfang war alles gut. Mehr Zeit zu zweit stand uns bevor. Wir zogen zusammen. Gemeinsam in das Haus. Das Haus, das sich freute, Leben in sich zu beherbergen.
Es wurde zu unserem zu Hause, unserem Rückzugsort. Eine Höhle in ungewissen Zeiten. Es öffnete sich uns, schenkte uns den Raum, den wir so lange gesucht hatten. Wir schätzten sein Angebot und gaben ihm zurück, wonach es verlangte. Wir beobachteten, planten, zeichneten und konstruierten. Gemeinsam machten wir uns daran es instand zu halten, seine Geschichte fortzuführen und ließen uns dabei vorsichtig mit einfließen.
Die Abschottung machte uns nichts aus. Im Gegenteil. Wir genossen die Ruhe. Wir nahmen die Zeit wahr, die uns sonst gestohlen wurde. Wir atmeten auf. Wir waren zu zweit. Und wir waren uns genug.
Eingestellt auf eine lange Zeit des Umbruchs draußen in der Welt, schmiedeten wir Pläne und wagten es über Grenzen hinaus zu träumen. Als wir einzogen war es Frühling und das Aufkeimen der Natur trug uns sanft über die Wochen. Mit den Pflanzen, die wir säten, gediehen auch wir. Wir verwurzelten uns mit der Erde und wuchsen zusammen.
Doch von der Verführung des Sommers und seinen langen Tagen ließen wir uns nicht blenden. Wir bereiteten uns auf den Winter vor, wenn die Nächte lang sein würden. Das langgeschnittene Haus wies uns den Weg. Wir richteten für jeden von uns einen Raum an den Enden des Hauses ein. Damit wir Luft zum Atmen hatten, wenn uns die Kälte näher zusammentreiben würde.
Es wurde gemütlich. Durch den gewonnenen Raum nahmen wir uns Zeit für uns selbst. Gaben uns dem hin, was in uns war, wagten zuzulassen, verarbeiteten was nach außen dringen wollte. Dazwischen kamen wir in der Mitte des Hauses zusammen, aßen, tranken, liebten uns, tauschten uns aus, über das was in jedem von uns vor sich ging.
Die Veränderung kam schleichend. Immer mehr Zeit verbrachten wir getrennt in unseren Räumen. Gaben uns hin, uns selbst und den Forderungen der Welt, die es zu befriedigen galt. Denn die Welt hatte sich nicht an unser Zur-Ruhe-Kommen angepasst.
Vielleicht hat uns das Haus zu sehr verwöhnt. Vielleicht haben wir uns von der Verlockung eines ruhigeren Lebens verführen lassen, ohne die Folgen abzuschätzen. Vielleicht haben wir uns unterschätzt. Vielleicht waren wir nicht bereit. Das denke ich, während ich im Bett liege und den Wind über das Dach pfeifen höre. Die Winterwinde haben eingesetzt.
Ich denke an die letzten Worte, die du zu mir gesagt hast. Aber ich kann mich nicht erinnern. Es ist zu lange her, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Eingeleitet hat das lange Schweigen eine wortkarge Zeit. Es gab keinen besonderen Anlass. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche haben wir uns immer weiter voneinander entfernt. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Miteinher ging eine Distanz, die uns zu erschlagen drohte. Die uns dazu brachte, noch mehr Abstand zwischen uns zu bringen. Wir haben begonnen den anderen auszusperren und uns selbst einzusperren. Wie scheue Tiere schleichen wir durch die Räume, immer Bedacht darauf, dem anderen nicht zu begegnen.
Ich habe vergessen, wie du riechst, wie du schmeckst, selbst wie du aussiehst. Nachts liege ich im Bett und versuche mich zu erinnern. An unsere erste Verabredung. An die Wärme deiner Hände. An deinen gleichmäßigen Atem, wenn du schläfst. Ich spiele alles was wir gemeinsam erlebt haben immer wieder durch. Doch der Mensch, der nur wenige Meter entfernt von mir ist, scheint mit dem aus meiner Erinnerung nichts gemein zu haben.
Oder doch? Ich kann es nicht mehr einschätzen. Die Isolation benebelt mich. Ich wage es nicht aufzustehen, zu dir zu schleichen, unter deine Decke zu kriechen, wieder mit dir eins zu werden, so wie früher. Zu groß ist die Angst, dass du mich abweist. Zu groß die Scham davor, deinen Freiraum nicht zu respektieren.
Eine Sturmböe peitscht die Äste des Baums gegen mein Fenster. Ich frage mich, ob das Haus vorausgesehen hat, was mit uns passieren wird. Und ich frage mich, wieviel das Haus, so wie es hier steht und dem Wind trotzt, zu unserer Situation beigetragen hat.
Ich nehme mir vor, morgen wenn die Nacht vorbei ist, einen Schritt zu wagen. Morgen, wenn ich dich in der Küche höre, werde ich nicht in meinem Raum bleiben, so wie sonst. Ich nehme mir vor, die Küche zu betreten und dich anzusehen. Ich werde nichts sagen. Ich glaube, wir sollten es langsam angehen.